Fábula / Fabel
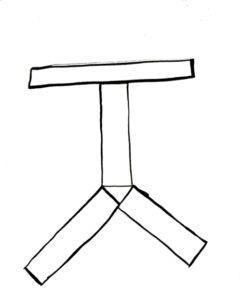
„It will be an honour for me to receive a pretty but useless thing from you.”
— Bruce Chatwin, The Morality of Things
1
Wer W.G. Sebalds „Elementargedicht“ „Nach der Natur“ aufschlägt und das Blatt zweimal wendet, liest zunächst die Ankündigung von Schnee auf den Alpen und nach einer weiteren Wendung den Auftakt: Wer die Flügel des Altars der Pfarrkirche von Lindenhardt zumacht und die geschnitzten Figuren in ihrem Gehäuse verschließt, dem kommt auf der linken Tafel der hl. Georg entgegen. Das Zumachen der Altarflügel, die dabei kleiner und handlicher werden, als man sich Altarflügel eigentlich vorstellt, und die sich schließen wie die Flügel eines Marienkäfers oder einer Muschel; das Verschwinden der Figuren im Schatten dieser Flügel und das Auftauchen schließlich des heiligen Georg als ein Entgegenkommen von links: auch ohne bereits von dem Interesse für den Maler Matthaeus Grünewald zu wissen, dem der erste Teil von „Nach der Natur“ gewidmet ist, nimmt uns die Bewegung dieses Satzes gleich hinein in die besondere Art der Wachsamkeit gegenüber dem Kunstwerk und führt uns heran an die vor aller Gelehrtheit an einer intuitiven und persönlichen Achtung geschulte Wertschätzung, die Sebalds gesamtes Schreiben über andere auszeichnet. Gleich schon greift der Betrachter an die Altarflügel und holt den heiligen Georg sich mit Händen heran, anstatt ihn sich auf Distanz zu halten, etwa um ja sich nicht voreilig vereinnahmen zu lassen von dem Drachentöter. Zuvorderst steht er am Bildrand, eine Handbreit über der Welt, und wird gleich über die Schwelle des Rahmens treten. Sebald hat sich nie dabei aufgehalten, sich nicht vereinnahmen zu lassen, sondern war sich im Gegenteil immer bereits der Vorvereinnahmung bewusst, der Präsenz einer Geschichte, die vor uns begann und nach uns weitergeht und von der es uns bisweilen scheint, dass sie uns erzählt mehr noch als wir sie. Lang vor der Zeit geht der Schmerz bereits ein in die Bilder. Es gibt keinen Anfang der Wertschätzung und unsere vornehmste Aufgabe ist es, sie nicht enden zu lassen.
2
„Jetzt haben auch wir etwas“, sagten die Leute von Visoko in Bosnien, als einer der ihren aus dem amerikanischen Exil zurück kehrte und die spitz gipfelnden Hügel rund um die Stadt zu Pyramiden erklärte, die einst Menschenhände geschaffen hätten. Während dieser eine nun Schächte in die Hügel gräbt, um zu beweisen, was er in die Welt gesetzt hat, bauen die Leute von Visoko Pharaonengräber in ihre Keller für die Touristen. Wenn der eine eines Tages die Gräber in den Hauspyramiden fände, sagen sie, könne man die Gräber in den Kellern immer noch dem Original getreu umbauen. Einstweilen hält man sich an die Ägypter. Die EU schickt einen Kommissar, um der Quelle beim Sprudeln zu helfen, denn man glaubt, dass der Tourismus für viele Regionen die einzig verbleibende Lebensader sei und überdies die sicherste Route von einem Europa ins andere. Hotels und Pensionen werden zertifiziert, Cafés mit Logos versehen und Wanderrouten mit Wegweisern markiert. Er glaube nicht an die Pyramiden-Theorie, sagt der Kommissar, aber darauf komme es auch gar nicht an. Visoko sei ein Vorzeigemodell dafür, wie sich eine benachteiligte Region mit Erfindergeist aus der Misere päppeln könne.
3
Wie lange braucht man, um eine der Pyramiden in Gizeh zu umlaufen? Wie lange, sie zu besteigen? Und wie lange müsste man durch die Wüste wandern, um die Qualen aufzuwiegen, die der Bau der Pyramiden in die Welt gebracht hat? Die Zivilisation kam unter Peitschenhieben zur Welt, und wir haben die Last geerbt, schreibt Bruce Chatwin in „The Nomadic Alternative“, einem Buch, das er nie geschrieben hat und das doch posthum veröffentlicht wurde. Wenn man lange genug den Blick nicht abwendet, stelle ich mir vor, lässt das Flimmern der Hitze, die aus der Wüste aufsteigt, die scharfen Kanten der Pyramiden flattern im Wind wie ein Zelt. Ein Zelt, das mit wenigen Handgriffen eingeholt und verstaut wird in einer Satteltasche, um später an einem anderen Ort erneut zu einer flüchtigen Behausung zu werden. Warum haben die Bauwerke, in denen die Ewigkeit verscharrt wurde, die gleiche Form, wie die leichten Behausungen der Nomaden, für die noch der Ort in einem ebenso rhythmischen Fluss war wie die Zeit?

Chatwin schreibt: Ein Nomade ‚wandert’ nicht ‚ziellos von einem Ort zum anderen’, wie es ein Wörterbuch gerne hätte. Das Wort stammt aus dem Griechischen und heißt ‘weiden’. Die Wanderungen der Hirtenstämme folgen höchst konservativen Mustern, von denen sie nur in Dürrezeiten oder bei Katastrophen abweichen. Die dauerhafte Dürre und die endgültige Katastrophe, die den Nomaden zum Wilderer und Vertriebenen macht, trägt den Namen ‚Zivilisation’ und ist aus Sicht der Nomaden nichts anderes, als die Behäbigkeit der Anderen. Wir hätten uns angewöhnt, schreibt Chatwin, der Sesshaftigkeit das Barbarische, die Wildnis und das Tierhafte gegenüberzustellen, und unterschlügen dabei, dass die glorreiche Errungenschaft ‚Zivilisation’, in die wir unser Selbstverständnis investieren, nichts weiter bedeute als ‚Leben in Städten’. Leben also in geschlossenen Räumen, umgeben von Dingen, deren schiere Schwerkraft uns ankert, wo uns nicht schon die Architektur zum Kerker geworden ist.
Kapitel V wird die Geschichte der Nomaden weitererzählen, die sich einer siegreichen Ackerbau- und später Industriekultur gegenüber sahen. Ich könnte es ‚Zivilisation oder Tod’ nennen, die Losung des amerikanischen Siedlers auf dem Weg nach Westen. Ich werde darin die harten Methoden beschreiben, mit denen gegen Nomaden vorgegangen wird, den rationalisierten Hass und die Anmaßung moralischer Überlegenheit. Nomaden werden mit Tieren gleich gesetzt und entsprechend behandelt. Ich werde das Schicksal der Zigeuner, der amerikanischen Indianer, der Lappländer und der Zulus erörtern, auch das von Nomaden innerhalb höchst zivilisierter Gesellschaften, Tramps, Vagabunden, Unbehauste etc. Ich würde über die Beja im östlichen Sudan berichten, die fuzzy-wuzzys von Kipling. Sie konnten sich allen zivilisatorischen Einflüssen widersetzen, seit sie vor rund dreitausend Jahren zum erstenmal in den Annalen der Ägypter auftauchten – nur weil sie gewillt waren, sich mit dem allergeringsten persönlichen Komfort zu begnügen. Sie pflegen einen sensationellen Müßiggang und eine ebensolche Aufsässigkeit. Den größten Teil des Vormittags verbringen die Männer damit, sich auf die fantastischste Weise gegenseitig die Haare zu ondulieren.
Ich wünschte, Chatwin hätte das Buch geschrieben, das er in einem Brief an den Herausgeber Tom Maschler skizzierte. Vielleicht war er immer schon zu nah dran an diesem Buch, um es zu schreiben, oder einfach zu viel unterwegs. Mit einigem Recht wird aber auch behauptet, er habe das Buch, das er nie schrieb, ja doch geschrieben, verteilt auf all die anderen Bücher und Storys und Skizzen wie eine Mahlzeit unter Freunden oder die Habe eines Reisenden, der nicht weiß, wann er zurückkommt und ob überhaupt.
4
Was er an Kunst und an Wissenschaft überblickt, ist samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen betrachten kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern in mehr oder minderem Grade auch der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Diese viel zitierten Sätze Walter Benjamins, die vom historischen Materialismus handeln und dem zeitgenössischen Sammler Eduard Fuchs gewidmet waren, säen grundsätzliche Zweifel daran, ob wir jemals sehen, was zu sehen wäre. Zivilisationsgeschichtlich verkörpert die Pyramide die monumentale Anstrengung, die sinnliche Anschauung des Gegenstandes von seiner Bedeutung zu trennen und auf Abwege zu führen zu einem ganz anderen Inhalt. Bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel steht die Pyramide daher exemplarisch für das „Zeichen“: den für die Sprache entscheidenden Umschlag von einem mimetischen Umgang mit der Welt zu einem abstrakten. Das Zeichen ist irgendeine unmittelbare Anschauung, die einen ganz anderen Inhalt vorstellt, als den sie für sich hat – die Pyramide, in welche eine fremde Seele versetzt und aufbewahrt ist. Anders als dem Symbol sieht man dem Zeichen nicht mehr an, wofür es steht. Man muss es lernen und sich merken. Die Arbitrarität des Zeichens, die anfängliche Willkür, die am Werke ist, wenn das Zeichen mit seiner Bedeutung versehen wird, ermöglicht uns die Sprache als objektive Währung für den subjektiven Aufruhr. Wenn Hegel ausgerechnet die Pyramide an den Anfang der Sprache stellt, so legt er nahe, dass diese affiziert ist von der willkürlichen Gewalt, mit der Tausende ins Vergessen verschlissen wurden, damit sich einer einen Namen mache. Am Grunde der Sprache liegt demnach ein Vergessen. Wir haben hier eine gedoppelte Architektur vor uns, schreibt Hegel, eine überirdische und unterirdische: Labyrinthe unter dem Boden, prächtige, weitläufige Exkavationen, halbe Stunden lange Gänge, Gemächer, mit Hieroglyphen bedeckt, alles aufs sorgfältigste ausgearbeitet; dann darüber hingebaut jene erstaunenswerten Konstruktionen, … die Pyramiden …

Jacques Derrida erinnert in seiner Hegel-Lektüre daran, dass die Pyramide ein Grab ist und dass demnach in jedem Sprechen etwas zu Grabe getragen wird. Und er erinnert auch an ein Vergessen, das bereits in der stummen Vorgeschichte des Sprechens stattgefunden hat, dort wo Hegel die „Einbildungskraft“ verortet. Es geht dabei um den ganz grundlegenden Vorgang, einen Gegenstand der sinnlichen Erfahrung, also etwas Aktuelles, zu einem Bild zu machen, zu einem Inhalt des Denkens. Es geht also um das Erinnern als die Verinnerlichung der äußeren Welt, die bei Hegel den Beginn der „Intelligenz“ markiert: In ihr (der Intelligenz) erinnert ist das Bild, nicht mehr existierend, bewusstlos aufbewahrt, schreibt Hegel, und Derrida schlägt vor, diesen unbewussten Aufbewahrungsort der Bilder als einen „Schacht“ zu bezeichnen, dessen Todesstille von der verhaltenen Kraft all der Stimmen erfüllt ist, die er in sich hortet. Von dort, schreibt er, führt ein Weg zu jener aus der ägyptischen Wüste mitgebrachten Pyramide.
Wieder eine gedoppelte Architektur, der Schacht und die Pyramide, und in beidem ein Vergessen. Im zweiten, früheren Fall liegt das Vergessen jedoch noch näher an der Wurzel des Erinnerns. So nah, dass es scheint, Erinnern hieße Vergessen. Vergessen, dass nicht ich es war, der das Bild mir eingab, sondern der Wald aus Dingen, der mich umgibt, oder ein anderer, der dort vor mir herging und über eine Wurzel stolperte, bevor er sagen konnte, was er bereits auf der Zunge hatte.
5
Auf eine für Viele enervierende Art spielen die zentralen Begriffe der Hegelschen Philosophie mit dem Tod. Negation, Aufhebung, Dialektik. Derrida bündig: Die ‚Phänomenologie des Geistes‘ beschreibt das Werk des Todes. Der Geist, um den es Hegel zu schaffen ist, muss gewissermaßen durch ein Tal des Todes. Leichen pflastern seinen Weg. Ein Western also, aber all das nur für eine Handvoll Dollar? Derrida stellt die Frage nach dem Gewinn dieser grausamen Zivilisierung:
Wenn die Investition in den Tod sich nicht in voller Höhe amortisieren würde (selbst im Falle eines Gewinnes, eines Einkommensüberschusses), könnte man dann noch von einer Arbeit des Negativen sprechen? Was wäre ein ‚Negatives’, das sich nicht aufheben ließe? Und das, im Ganzen genommen, als Negatives, aber ohne als solches zu erscheinen, ohne sich zu präsentieren, das heißt ohne im Dienste des Sinnes zu arbeiten, reüssieren würde? Dass also ganz umsonst reüssieren würde?
Und er schlägt vor, sich eine „Maschine“ vorzustellen, die in ihrem reinen Funktionieren definiert wäre und nicht in ihrer finalen Zweckmäßigkeit, in ihrem Sinn, ihrem Ertrag, ihrer Arbeit. Eine solche Maschine hätte als wesentlichen Effekt einen reinen Verlust und die Philosophie, vermutet Derrida, sähe darin zweifellos ein Nicht-Funktionieren, eine Nicht-Arbeit, und sie würde dadurch das verfehlen, was in einer solchen Maschine eben doch läuft. Von alleine. Draußen. Es scheint, als hoffe Derrida, über den Umweg einer solchen zweckfreien und verschwenderischen Maschine, die Hegel niemals zu denken vermocht hat, zu einem anderen Umgang von Mensch zu Mensch zu kommen. Ein klassisch utopischer Einfall, wo doch Derrida bekannte, dass Utopien ihm suspekt sind und er sich lieber an das Unmögliche halte. Es ist ihm klar, dass Sprache und Kultur von einer Investition in den Tod gesponsert werden und dass dieses Faktum vor der Philosophie liegt. Der Skandal, dass am Beginn meines Lebens der Tod eines Anderen steht, ist ein bekanntes Sujet und lässt sich durch eine Textexegese nicht aus der Welt schaffen. Diese ganze Logik, diese Syntax, diese Sätze, diese Begriffe, diese Namen, schreibt Derrida, diese Sprache Hegels – und, bis zu einem gewissen Punkt, dieser selbst – sind in das System dieses Unvermögens, dieser strukturellen Unfähigkeit, ohne Aufhebung zu denken, miteinbezogen. Es genügt folglich, sich in diesem System vernehmen zu lassen, um es zu bestätigen. Zum Beispiel eine Maschine Maschine, ein Funktionieren Funktionieren, eine Arbeit Arbeit zu nennen usw. Und Derrida weiß, dass es nicht genügt, die Hierarchie umzustoßen oder die Richtung der Bewegung umzukehren, der Technik und der Konfiguration ihrer Äquivalente eine ‚Essentialität’ zuzuschreiben, um damit auch schon die Maschine, das System oder das Terrain zu wechseln.

6
Die Maschine ist keine unschuldige Erfindung. Die Furcht vor der Maschine, diese könne uns zermalmen, oder schlimmer noch, uns überflüssig machen, folgt der gleichen Furcht, mit der wir auf die Fremdheit des Anderen reagieren. Die Furcht setzt die Dialektik in Gang, das Erklären, Bedeuten und Benennen des Anderen, seine Aufhebung und dann seine Rückkehr als meine Welt und mein Anderer. Vor der Dialektik liegt der „Schock des Heterogenen“. Für die Kunst unterscheidet Jacques Rancière zwei verschiedene Formen, auf diesen Schock zu reagieren: die dialektische und die symbolistische. Weil er sich Jean-Luc Godards Histoire(s) du cinéma als Beispiel vorlegt, spricht er dabei jeweils von „Montage“, verwendet den Begriff jedoch im weiteren Sinn von Nebeneinanderstellen, oder im gleichen Rahmen Anordnen.
Die dialektische Montage fragmentiert Kontinuitäten und entfernt Worte oder Bilder voneinander, die sich eigentlich anziehen, oder sie bringt im Gegenteil heterogene Worte oder Bilder zueinander und vereint Unvereinbares. Das Zusammentreffen des Unvereinbaren legt die Macht einer anderen Gemeinschaft offen, die einen anderen Maßstab durchsetzt.
Erinnern wir uns inmitten dieser Rebellion an Derridas Bemerkung, dass es nicht ausreicht, die Hierarchien umzustoßen und gewissermaßen das Unterste zuoberst zu kehren. Es kommt darauf an, welche Kontinuitäten fragmentiert und wessen Maßstäbe der Attraktion und der Unvereinbarkeit hier kassiert werden. Typischerweise geht es in der dialektischen Montage darum,
eine Welt hinter einer anderen Welt sichtbar zu machen: der weit entfernte Konflikt soll hinter dem Komfort des amerikanischen homes aufscheinen, die von den urbanen Erneuerungen verdrängten homeless erscheinen hinter den Hochhäusern und den alten Emblemen der Polis, das Gold der Ausbeutung hinter den Rhetoriken der Gemeinschaft oder den Erhabenheiten der Kunst, die Gemeinschaft des Kapitals hinter allen Trennungen der verschiedenen Bereiche und der Klassenkampf hinter allen Gemeinschaften. Ein Schock muss organisiert und die Fremdartigkeit des Familiären inszeniert werden, um eine andere Ordnung der Maße aufzuzeigen, die nur durch die Gewalt des Konflikts entdeckt werden kann.
Die symbolistische Montage geht mit dem Schock der Heterogenität anders um. Man könnte sagen, sie erleidet ihn, während die dialektische Montage ihn forciert.
Die symbolistische Montage versucht tatsächlich, eine Familiarität zwischen den fremden Elementen zu inszenieren, eine zufällige Analogie, die von einer grundlegenderen Beziehung der gegenseitigen Zugehörigkeit zeugt, von einer gemeinsamen Welt, in der die heterogenen Elemente demselben wesentlichen Gewebe angehören und somit immer unter dem Verdacht stehen, sich miteinander in der Brüderlichkeit einer neuen Metapher zu verbinden.

So wenig die dialektische Montage sich im Umsturz der alten Ordnung erschöpft, so wenig läuft die symbolistische Montage stets auf die Fabrikation einer vorschnellen Harmonie hinaus. In ihren besten Momenten gelingt der Brüderlichkeit einer neuen Metapher, dem Vermögen zur Berührung und nicht zur Übersetzung oder Erklärung, ein Erinnern, in dem kein Vergessen verrechnet ist. Natürlich ist dieses Gelingen abhängig von der „Freiheit der Kunst“, das Piktorale und das Verbale gleichwertig zum Einsatz zu bringen und dem Vergessen, das in jedem Sprechen erneuert wird, beizeiten ein brausendes Schweigen zur Seite zu stellen, das uns ins Erinnern stürzt. Rancières gesamte Argumentation in „Politik der Bilder“ lebt von dem Vorschuss, dass die Kunst aus Bildern [besteht] und dass ein Bild nicht ausschließlich ein Element des Sichtbaren sein muss. Es gibt Sichtbares das kein Bild ist, und es gibt Bilder, die nur aus Worten bestehen, schreibt er und benennt damit das eigentümliche Funktionieren der Maschine, die er nun enthüllt:
Während die dialektische Montage durch den Schock der Unterschiede das Geheimnis einer heterogenen Ordnung aufzeigen will, versammelt die symbolistische Art der Montage verschiedene Elemente in der Form des Mysteriums. Mysterium heißt hier nicht Rätsel oder Mystik. Mysterium ist eine ästhetische Kategorie, die von Mallarmé entwickelt und von Godard explizit wieder aufgenommen wurde. Das Mysterium ist eine kleine Theatermaschine, die Analogien fabriziert und die es ermöglicht, die Gedanken des Dichters in den Füßen der Tänzerin, den Falten einer Stola, dem Entfalten eines Fächers, dem hellen Schein eines Kronleuchters oder der unerwarteten Bewegung eines aufgerichteten Bären zu erkennen.
7
Es gibt eine Sehnsucht nach Notwendigkeit. Das Problem ist, dass diese Behauptung meist im falschen Zusammenhang steht und einem deshalb nichts übrig bleibt, als auf seiner Freiheit zu bestehen. Aber es gibt eine Sehnsucht nach Notwendigkeit. Eine Sehnsucht nach Physik, nach Reibung, danach, dass die eigene Praxis sich an einem Körper abarbeiten kann, der sein eigenes Beharren hat und sich nicht verflüssigen wird im Abrakadabra meiner Freiheit. Notwendigkeit ist, was du küsst oder wo du dir den Kopf dran stößt, schreibt John Berger. Wie könnten wir darauf verzichten? Das Desaster beginnt, wenn der Mangel an Notwendigkeit als das Versagen von Autorität interpretiert wird. Wo es um den Raum zwischen mir und dir geht, zwischen mir und den Dingen, wird nach den Instrumenten der Macht gerufen. Dabei haben wir noch nicht einmal angefangen, unsere Freiheit wirklich zu gebrauchen. Wir sollten uns das nicht gefallen lassen. Wenn sie von Autorität reden, dann sollten wir von Freiheit reden, und wenn sie von Freiheit reden, dann sollten wir von Notwendigkeit reden, und wenn sie von Notwendigkeit reden, dann sollten wir von den Toten reden, und wenn sie es wagen, von den Toten zu reden, wie sie es gerne tun, dann sollten wir sie auffordern, uns diese zurück zu geben.
Wer die Klage über den Mangel an Notwendigkeit mit dem Ruf nach Autoritäten beantwortet, der wird uns auch weismachen wollen, dass wir „das Ende der Utopien“ erlebt haben. Parallelen, wird uns gesagt, sind Linien, die sich niemals treffen. Egal welcher wir folgen, wir werden nie wieder die andere zu Gesicht bekommen. Zu Gesicht bekommen vielleicht, aber doch außer Reichweite, in gleich bleibender Distanz, als Prospekt. Parallelen, wird uns gesagt, sind Linien, die sich im Unendlichen treffen. Vielleicht lohnt es sich, gegen alle Wahrscheinlichkeit diesen Punkt im Unendlichen anzusteuern. Womöglich wird man darüber gar nicht zum Sisyphos, sondern muss nur die Hebelwirkung zu nutzen wissen und den Anfang der Parallelen so mit dem Fuß belasten, dass sich ihr Ende aus der Unendlichkeit hebt und zu einem herüber biegt.
Die Autorität hat das Terrain vermessen, vermint, ausgepreist, mit Bewegungsmeldern versehen und sich zurückgezogen. So weit, dass sie zum Fluchtpunkt geworden ist, den keiner mehr sieht und an dem doch die Fäden zusammen zu laufen scheinen. In der Unendlichkeit oder im eigenen Begehren, das scheint aufs Gleiche hinauszulaufen. Kann es sein, dass dort, wo einmal die Utopien geweidet haben, die Autorität ihre Einkaufswelten errichtet hat?
8
In „The shape of a pocket“ macht sich John Berger daran, die Welt auf den Kopf zu stellen, indem er die Dinge aus dem Exil zurückholt. Zurück in die Berührung unserer Körper, wo sie uns ein taktiles Gefühl von Notwendigkeit geben und einen Begriff von Wirklichkeit frei von lärmender Euphorie und stummem Geschrei.
Notwendigkeit ist die Art, wie das Existente gegeben ist. Sie macht die Wirklichkeit wirklich. Doch die Mythologie des Systems bedarf nur des Noch-Nicht-Wirklichen, des Virtuellen, des nächsten Einkaufs. Im Betrachter erzeugt dies nicht – wie behauptet wird – ein Gefühl der Freiheit (der so genannten Wahlfreiheit), sondern eine tiefe Isolation.
Dagegen ein Kuss, eine Beule am Kopf… Berger holt nicht nur die Dinge heraus aus den Schaufenstern und Wohnwelten, sondern auch die Gegenstände der Malerei heran aus der Distanz der Vorlage. Beide Gesten folgen bei ihm derselben Notwendigkeit, der Rehabilitation der Wirklichkeit. Nicht etwa aus dem Schuldgefühl eines post-industriellen Menschen, der „die guten alten Dinge“ vermisst, sondern aus der Überzeugung heraus, dass uns mit der Nähe der Dinge auch der Maßstab für den eigenen Körper abhanden kommt und wir deshalb Gefahr laufen, im größten Unglück uns glücklich zu wähnen und den Moment des Glücks für einen falsch verbundenen Anruf zu halten.

Bergers „Schritte in Richtung einer kleinen Theorie des Sichtbaren (für Yves)“ sind ebenso sehr Schritte in Richtung einer Praxis des Handanlegens (für uns). Was die Malerei betrifft, kehrt er den Fachsimpeleien, die vor allem der Taxierung des Marktwerts dienen, einstweilen den Rücken und fragt stattdessen: Was ist allem Gemalten gemeinsam? Und er antwortet: Es verkündet, ‚Ich habe dies gesehen’. Malerei ist für ihn zu allererst eine Bestätigung des Sichtbaren, das uns umgibt, das ständig erscheint und wieder verschwindet. Ohne das Verschwinden gäbe es den Impuls zu malen vielleicht gar nicht, denn dann besäße das Sichtbare selbst die Gewissheit (die Permanenz), nach der das Malen strebt. Berger erinnert daran, dass die ersten Maler Jäger waren, und dass die Praxis des Malens und die des Jagens, gerade weil sie nicht identisch waren, in einer engen Beziehung zu einander standen.
In einigen frühen Höhlenmalereien gibt es neben den Tieren Umrisszeichnungen der menschlichen Hand. Wir wissen nicht genau, welchem Ritual das diente. Wir wissen aber, dass das Malen die Aufgabe hatte, eine magische ‚Gemeinschaft’ zwischen Beute und Jäger zu bestätigen… Malen war das Mittel, diese Gemeinschaft explizit und daher (hoffentlich) dauerhaft zu machen.
Noch immer, schreibt Berger, lädt derjenige, der malt, den Gegenstand zur Kollaboration ein. Malend lasse ich mich auf eine Physik ein, die das Terrain des Gegenstandes ebenso ist wie das meine:
Nahe heran zu gehen, heißt Konventionen zu vergessen, Ansehen, Rechtfertigungen, Hierarchien und sich selbst. Es schließt auch das Risiko ein, aus jedem Zusammenhang zu fallen, bis zum Wahnsinn. Denn es kann passieren, dass der Maler zu nahe heran gerät und dann bricht die Kollaboration zusammen und er löst sich im Modell auf. Oder das Tier verschlingt den Maler, oder stampft ihn in den Boden.
Man wird nicht darum herum kommen zuzugeben, meint Berger, dass der Maler weniger Schöpfer ist, als vielmehr Empfänger. Was wie eine Schöpfung erscheint, ist der Prozess, in dem der Künstler dem von ihm Empfangenen eine Form gibt.
Es geht Berger keineswegs um die Demystifizierung des Malens. Im Gegenteil habe ich den Eindruck, dass es ihm darum geht, dem Malen sein Geheimnis zurück zu geben. Das Malen ist ihm dabei ein intimer Umgang mit der gleichen Welt, mit der es auch andere Praktiken zu tun haben, wenn sie sich auf die Physik einlassen, die unserem Leben Notwendigkeit und Grenze gibt. Dem Malen sein Geheimnis zurückgeben, heißt für Berger, den Dingen ihr Geheimnis zurück zu geben, und den Dingen ihr Geheimnis zurück zu geben, heißt anzufangen, sich auf die Notwendigkeit einzulassen, ohne sich nach Autoritäten umzuschauen. Und das heißt, die Utopien wieder auf die Weide zu führen.
Der Maler ist kontinuierlich auf der Suche nach einem Ort, an dem er das Abwesende willkommen heißen kann. Wenn er einen Ort findet, richtet er ihn her und hofft, dass sich das Gesicht des Abwesenden zeigt. Wie du weißt, kann das Gesicht des Abwesenden der Hintern eines Esels sein! Gott sei Dank gibt es keine Hierarchien.

9
Die Werkstatt des Künstlers ist immer seltener eine feste Adresse. In einem Briefwechsel mit dem Maler Leon Kossoff stellt sich John Berger dessen Atelier als einen Magen vor. Bei der Beschreibung eines Ateliers, schreibt Berger, werde immer viel Aufhebens um das Licht gemacht. Das verleite uns dazu, ein Atelier für ein Gewächshaus, ein Observatorium oder gar einen Leuchtturm zu halten. In Wirklichkeit jedoch sei der Raum, in dem ein Künstler arbeite, ein Verdauungsorgan, ein Ort der Verwandlung und der Ausscheidung. Oder nicht? Alles was du über das Atelier sagst, ist wahr, schreibt Kossoff an Berger. Tatsächlich bereite ihm das Licht wenig Kopfzerbrechen. Wenn es zu hell wird, drehe ich die Leinwand herum, oder beginne einen neuen Entwurf. Wände und Fußboden seien mit Farbe bedeckt, auf den Heizungen trockneten die Pinsel und unfertige Zeichnungen hingen an den Wänden. Es scheint, dass ich in einem endlosen Kreislauf von Beschäftigungen befangen bin. Den größten Teil der letzten vierzig Jahre hat man mich in Ruhe gelassen, aber dank der sich häufenden Ausstellungen und Atelierbesuche ähnelt der Ort mittlerweile einem verlassenen Schiff.
Artist in residence. Du sitzt in einem leeren Raum in einer fremden Stadt und wartest auf die Spedition, die dir das Werkzeug bringt. Die Spuren deines Vorgängers wurden zugeweißelt. Vielleicht hätte sich ein Anfangspunkt ergeben, indem du einen Faden aufgegriffen hättest, den er fallen lassen musste, weil die Spedition sein Werkzeug abholte. Weiße Wände stattdessen. „Was mache ich hier?“. Geschrieben ist die Frage akzentfrei. Ich ist bereits die Signatur einer Bewegung, die der Frage voraus ging; einer Bewegung, in deren Verlauf aqui zum hier wurde und ich die Sprache gewechselt hat, um in der Fremde zu einem wandernden Signifikanten zu werden, einem leeren Raum, der sich von allen bewohnen lässt. Hier ist der Ort, den die Sprache vermuten lässt. „Was mache ich hier?“ fragt nicht nach der Chronologie der vorangegangenen Ereignisse oder ihrer Folgerichtigkeit, sondern setzt einen Anfang. Die Frage ist nach einer Praxis, die diese drei ungebundenen Teile verknüpft: was, ich, hier.
An einem Deckenhaken hast du ein Laken befestigt und zwar so, dass es fiel wie ein Zelt, oder eine Pyramide. Du hast Bierflaschen gesammelt, die andere geleert hatten, und Plakate, die der Kleister aufgeworfen hatte, und hast beides zu Architektur erklärt. Es sei eine architektonische Geste, eine Bierflasche zu leeren, einen leeren Raum zu schaffen. Eine Sehnsucht, so gesehen. Ich dachte an das Geräusch in der Wüste Lop, über das Raoul Schrott eine Novelle geschrieben hat und von dem man nicht sagen kann, ob es das Rauschen des Windes oder das Rieseln des Sandes ist.
Eine Äolsharfe, sagt Török, der ungarische Professor, ist etwas, das die Welt hörbar macht. Zwischen die Äste der Eiche in Dodona hatte man Steine, Muschelschalen oder Tonfiguren gehängt, nahe genug, damit sie aneinanderschlagen konnten. Wie denn sonst soll man den Wind hören? Er wäre nicht einmal ein Rauschen; er wäre einfach nur Wind.
10
Während ich auf dich warte, fliegt ein Spatz durch die offene Tür ins Café, hüpft bis in die hinterste Ecke des Raumes, wo an der Wand der Brotkorb hängt, aus dem die Kellner die Tische bedienen, und wo wahrscheinlich Krümel auf dem Boden liegen. Kurz darauf fliegt der Spatz durch den ganzen Raum wieder zurück und aus der Tür heraus. Wenn sonst ein Vogel sich in einen geschlossenen Raum verirrt, denkt man: Er ist verloren, wenn ich ihm nicht helfe, er wird sich an den Fenstern zu Tode fliegen. Der zweite Teil von Sebalds „Nach der Natur“ ist dem Naturforscher Georg Wilhelm Steller gewidmet, den sein innerer Kompass unwiderstehlich nach Norden trieb. Von seinem ersten Landgang in Alaska wird beschrieben, wie sich ihm die Tiere völlig unbekümmert nähern und anschließen, Füchse, Elstern und Krähen, furchtlos vor ihm und voreinander. Womöglich ist das Zahme, die Arglosigkeit, der ursprüngliche Zustand der Tiere gegenüber dem Menschen, und das furchtsame Zurückweichen, die Scheu, erst erworben in Jahrtausenden schmerzhaft enttäuschter Erwartungen. Aber wir erleben zahme Tiere als degeneriert und sehen in der Scheu und im Misstrauen die „Frische des natürlichen Instinkts“. Eine Wunschprojektion möglicherweise unseres eigenen Jagdappetits, denn ein Tier, mit dem man kommunizieren kann, wird man schwerlich töten. Nur das stumme, scheue, fremde Tier, das vor uns flieht, wird uns zur Beute.
Später, in einer aus Fichtenstämmen zusammengefügten Behausung erlebt Steller bei Sebald die Wirkung verlassener Dinge in einem fremden Raum. Ein kreisrundes Trinkgefäß aus geschälter Rinde, einen mit Kupfererz durchsprenkelten Wetzstein, ein fischköpfiges Paddel und eine Kinderrassel aus gebranntem Ton sucht er mit Vorsicht aus und hinterlegt statt dessen einen eisernen Kessel, eine Schnur mit bunt aneinander gereihten Perlen, ein Fetzchen bucharischer Seide, ein halbes Pfund Tabak und eine chinesische Pfeife. An diesen schweigsamen Handel erinnert sich noch nach einem halben Jahrhundert, wie aus einem Bericht des Commandeurs Billings hervorgeht, einer der Bewohner dieser abgesonderten Gegend mit einem raschelnd nach innen gekehrten Lachen.
Die Erstbegegnung mit den Dingen eines anderen in einem fremden Raum ist ein eigentümlich unbewerteter Moment, der uns von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit oder auch Wertlosigkeit aller Dinge überzeugen kann. Diebstahl, Besitz und Gabe verlieren in diesem Raum ihre Schwere und machen Platz für Neugier, Tastsinn und den Wunsch, dem anderen in guter Erinnerung zu bleiben. Das Schönste an der von Sebald beschriebenen Szene ist daher das Lachen dessen, der sich ein halbes Jahrhundert später erinnert.
Tobias Hering

Veröffentlicht in André Sousa, Tobias Hering: Fábula/Fabel/Fable (Berlin, Künstlerhaus Bethanien, 2009). Das Buch wurde von Atlas Projectos gestaltet und entstand während André Sousas einjähriger Residency im Künstlerhaus Bethanien. Die Bilder und Fotos sind dem Bildessay von André Sousa entnommen, der darin den Text begleitet.
Der Text enthält Zitate aus den im Folgenden aufgeführten Werken. Übersetzungen von Zitaten folgen zumeist den bereits auf dem Markt befindlichen Übersetzungen, sofern diese zugänglich waren. Wo es angezeigt schien, hat sich der Autor die Freiheit genommen, die existierenden Übersetzungen anhand der Originaltexte leicht zu verändern.
Walter Benjamin
Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker, in: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt 1970
John Berger
The Shape of a Pocket, New York 2001
Deutsch: Gegen die Abwertung der Welt, aus dem Englischen von Hans-Jürgen Balmes, Frankfurt 2003
Bruce Chatwin
Anatomy of Restlessness, New York 1997
Deutsch: Der Traum des Ruhelosen, aus dem Englischen von Anna Kamp, München 1996
Jacques Derrida
Le puits et la pyramide, in: Marges de la philosophie, Paris 1972.
Deutsch: Der Schacht und die Pyramide, in: Randgänge der Philosophie, aus dem Französischen von Gerhard Ahrens, Wien 1988
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Die Hegel-Zitate sind ursprünglich aus dessen Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften sowie den Vorlesungen über die Ästhetik, folgen hier jedoch dem genannten Text von Jacques Derrida.
Jacques Rancière
Le destin des images, Paris 2003.
Deutsch: Politik der Bilder, aus dem Französischen von Maria Muhle, Berlin 2005
Raoul Schrott
Die Wüste Lop Nor, Frankfurt 2003
Winfried Georg Sebald
Nach der Natur. Ein Elementargedicht, Frankfurt/Main 1995
Die Geschichte der Pyramiden von Visoko nimmt Bezug auf den Dokumentarfilm Visoko flying high von Ira Hadžic.